von Winfried Asprion
Offene Grüne Liste Bürger im Mittelpunkt
Im Gemeinderat Horb im Gemeinderat Horb
Verantw.: Winfried Asprion (OGL)
Herrn
Oberbürgermeister
Peter Rosenberger
Marktplatz
72160 Horb a.N.
08. Oktober 2024
Antrag an den Gemeinderat
Guten Tag sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Rosenberger,
aktuelle Umfragen haben drei große Herausforderungen für Kommunen identifiziert: Digitalisierung, budgetärer Druck und demografischer Wandel. In der aktuell geltenden Haushaltssperre kulminieren u.E. alle Herausforderungen mit unterschiedlichen Gewichtungen und belegen aktiven Handlungsbedarf.
Im Hinblick auf verschiedene konkrete Problemfelder, die auf die Stadt Horb a.N. absehbar zukommen, als da beispielhaft wären
- große finanzielle Probleme, die die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushalts beeinträchtigen und notwendige Zukunftsinvestitionen verhindern
- ansteigender Personalmangel durch den allgemeinen Fachkräftemangel und die evtl. Unattraktivität der Arbeit im kommunalen öffentlichen Dienst
- fehlender Einsatz der Digitalisierung in allen Leistungsstufen der kommunalen Verwaltung und hier insbesondere die Bearbeitungsdauer bei der Unterstützung vorhandener und Ansiedlung von neuen für Horb attraktiven Wirtschaftsunternehmen
- neue Herausforderungen, die in politische Handlungsfelder münden und Ressourcen binden wie z.B. Hitzeschutzkonzept, Starkregenmanagement etc.
- veränderte Anspruchshaltung von Bürgern und Firmen an die Abläufe in der Verwaltung
sollte der Gemeinderat der Stadt Horb a.N. beschließen, eine Aufgabenanalyse, also die Erhebung aller Abläufe in der kommunalen Verwaltung durchzuführen, eine Bewertung dieser Aufgaben vorzunehmen und dies in ein Konzept der Neuausrichtung der Verwaltung unter den oben genannten Prämissen münden zu lassen.
Dabei geht es in erster Linie nicht um Personaleinsparung, sondern um Abwendung von Überlastungen der vorhandenen Belegschaft und ein schnelles Verwaltungshandeln, welches insbesondere in der ansässigen Wirtschaft zu spürbaren Vorteilen, auch gegenüber konkurrierenden Kommunen, führen kann.
Die Nutzung degressiver Skaleneffekte kann auch darin bestehen, personelle Umorganisaton der Fachbereiche vorzunehmen um die politische Zielsetzung, die der Gemeinderat beschließt, zu erfüllen.
Dabei geht es auch darum, das Aufgabenspektrum eher in die Richtung Pflichtaufgaben auszurichten und freiwillige Aufgaben entweder neu zu beschreiben oder zu reorganisieren.
Nach Möglichkeit sollte Benchmarking dazu genutzt werden, Unterschiede und Handlungsansätze herauszuarbeiten und in konkrete Umsetzungen münden zu lassen. Hier müssen u.E. externe Unterstützer wie z.B. KGSt oder Bertelsmann-Stiftung mit einbezogen werden.
Sicherlich ist es vielen Fällen erforderlich, dass Bund und Land ihre Zusagen einhalten, Zahlungsmittel erhöhen oder eine andere Förderung angehen. Allerdings sollte die Stadt Horb schon jetzt alles in ihrem eigenen Bereich mögliche tun, um zukunftsfähig zu werden.
Der gesamte Prozess wird Geld kosten. Allerdings ist ein Beharren auf dem status-quo und ständiges Flicken an den Prozessen der konsequenten Zukunftsausrichtung nicht dienlich.
Deshalb beantragt die Zählgemeinschaft OGL/BiM folgendes:
Der Gemeinderat möge beschließen, dass schnellstmöglich externe Projektpartner für eine ganzheitliche Aufgabenanalyse und Neuausrichtung (unter Einbezug von Benchmarking und Preiskalkulation erbrachter Aufgaben) angefragt werden und diese ihre Projektplanung im Gemeinderat vorstellen sollen.
Als Erstinvestment für die Durchführung dieser Maßnahme möge der Gemeinderat eine Summe von 50.000 Euro bereitstellen.
Als Lenkungsgremium soll der VTA/BA bzw. die Haushaltsstrukturkommission eingesetzt werden.
Echt-Studien über bisher durchgeführte Maßnahmen in anderen Stadtverwaltungen, wobei auch Städte in unmittelbarer Umgebung von Horb dabei sind, zeigen mittelfristige Kosteneinsparungen von beginnend 2 Mio. Euro bis zu 6,9 Mio. Euro aufwachsend in den folgenden 2-3 Jahre nach Umsetzung.
Mit einer methodisch klaren und nachvollziehbaren Vorgehensweise, die gewünscht eine öffentliche Diskussion begleiten soll, sind die gewünschten Ziele „dauerhafte Konsolidierung“, „Optimierung der Leistungserbringung“ und einer systematischen, nachvollziehbaren und fortschreibungsfähigen Stellenbedarfsermittlung inkl. Stellenbewertung zu erreichen. Das bisher vielfach angewandte „Gießkannenprinzip“ ist absolut nicht zukunftsfähig.
Es geht darum, auch im Vergleich mit anderen Verwaltungseinheiten ein methodisch-organisatorisches Vorgehen umzusetzen und unter Einbezug der Beschäftigten Schwachstellen aufzudecken, Verbesserungen zu entwickeln und die Aufgabenerledigung der Verwaltung hinsichtlich der Wirkung und des Ressourcenverbrauchs zu analysieren.
Dabei darf es nicht um eine kurzfrisitge Effekthascherei handeln, sondern es muss sich um eine grundlegende Untersuchung der Verwaltung unter Einbeziehung des Gemeinderats handeln.
Die Aufgabenanalyse mündet in der Aufgabenkritik, die sich die Fragen zu stellen hat:
- welche Aufgaben werden erledigt?
- für wen werden die Aufgaben erledigt?
- welches Ziel soll erreicht werden?
- ob für die Zielerfüllung überhaupt noch ein aktuelles Bedürfnis vorliegt? (Bürokratieabbau!)
- evtl. ist Ausfluss der Erhebung und Auswertung auch eine Neubepreisung bzw. Änderung in der Gebührengestaltung der Stadt
- Aufbau einer interkommunalen Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft i.S. Beschaffungen, um Kostendegressionseffekte zu erreichen.
Wer Bürgerorientierung (Einwohner und Gewerbebetriebe) ernst nimmt, muss an die Kundenorientierung privater Unternehmen anlehnen und bereits bei der Zielsetzung primär an die „Abnehmer“ denken. Hierbei darf nicht vergessen werden, dass sich bei einer echten Bürgerorientierung automatisch die Frage nach Zielkorrekturen und Aufgabenänderungen ergibt.
Anders als bei pauschalen Ausgabenkürzungen wird in Kenntnis der Auswirkungen auf die Zielerreichung zunächst festgesetzt, welche Änderungen bei der Aufgabenerledigung gewünscht werden. Allerdings muss die Haushaltswirksamkeit dieser Einsparung auch nachgehalten und durchgesetzt werden, was ein Nachteil gegenüber Haushaltskürzung pauschaler Art im traditionellen Verfahren ist.
Es ist leider so, dass traditionelle Haushaltskonsoldierungsmaßnahmen durch pauschale Ausgabenkürzungen nach der altbekannten „Rasenmähermethode“ erbracht werden. Dies passt allerdings nicht in die modernen Managementüberlegungen zur outputorientierten Verwaltungssteuerung. Begleitend werden die Herausforderungen der Zukunft, die unweigerlich kommen und der politischen Einflußnahme durch den Gemeinderat unterliegen, in vielen Fällen nicht mehr angegangen bzw. priorisiert.
Der Bundesrechnungshof hat zur Frage der Aufgabenkritik in Verwaltungen u.a. folgende Auffassungen:
- Aufgabenkritik ist eine Daueraufgabe der Verwaltung, die sich an zuvor festgelegten Zielen orientieren muss. Sie besteht aus drei wesentlichen Schritten: 1. Erstellen des Aufgabenkatalogs, 2. Zweckkritik, 3. Vollzugskritik
- Bei der Katalogisierung der Aufgaben ist darauf zu achten, dass alle Aufgaben der Behörde vollständig und hinreichend detailliert erfasst werden.
- Alle bestehenden Aufgaben sind zunächst auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen. Für notwendige Aufgaben ist anschließend zu klären, ob sie in reduziertem Umfang oder besser von anderen Stellen wahrgenommen werden können (Zweckkritik).
- Ist im Wege der Zweckkritik geklärt, dass eine Aufgabe dauerhaft in der Behörde wahrgenommen werden soll und wie ihr Ergebnis aussehen soll, setzt die Vollzugskritik ein. Sie prüft vor allem, ob die Aufgabe mit gleichem Ergebnis kostengünstiger wahrgenommen werden kann.
Das Public Management (PM) umfasst auch die Prüfung, ob eine Auslagerung von Aufgaben auf private Unternehmen und non-profit-Organisationen möglich ist. Das Land Baden-Württemberg wird z.B. künftig vereinheitlichte Feuerwehrfahrzeuge ausschreiben und durch Mengeneffekte deutlich bessere Preise erzielen. Auf Ebene der Kommune bindet dies keine Kapazitäten und spart dadurch im Endeffekt deutlich ein. Deshalb sollte auch die Stadt Horb dieses neue Angebot umgehend nutzen.
In diesem Zusammenhang kommt Konzepten eines Management by Objectives (MbO) bzw. eines Kontraktmanagements eine zentrale Bedeutung zu. Diese Konzepte sind gekennzeichnet durch den Abschluss einer Zielvereinbarung. Gemeinderat und Verwaltung treffen hier eine Vereinbarung über die von den Fachbereichen zu erzeugenden Leistungen und Produkte sowie über die dafür vorgesehenen Budgets.
Ein weiterer Vorteil der Aufgabenkritik kommt den Beschäftigten zugute. Eine Überlastunggsituation einzelner Mitarbeiter wird nachhaltig vermieden. Dazu kommt, dass kleine, bisher verdeckte MAK-Anteile effektiv gehoben und nutzbringend eingesetzt werden können. Die Sozialverträglichkeit ist erheblich höher und die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden dementsprechend besser. Es gibt keine motivationshemmenden pauschalen Stellenkürzungen bei ungeschmälertem Aufgabenvolumen, die für die Betroffenen Merharbeit bedeuten. Statt dessen werden im Wege der offenenen Beteiligung der Beschäftigten Aufgaben ermittelt, die wegfallen. In diesem Zuge ist auch die Einführung einer aktiven leistungsorientieren Entlohnung zu prüfen, die u.U. Nachteile hinsichtlich des Einkommens in Gegenüberstellung zur privaten Wirtschaft kompensieren kann, ohne die Gesamt-Personalkosten entscheidend zu tangieren. Der Personalrat der Stadt Horb ist daher zwingend als Mitglied im Lenkungskreis aufzunehmen.
An dieser Stelle sei auf das Vorgehensmodell aus dem Organisationshandbuch des Bundesministerium des Inneren hingewiesen, was beigefügt wird.
Beispielhaftes Vorgehensmodell angelehnt an die Empfehlungen des „Handbuchs für
Organisationsuntersuchungen und Personalbedarfsermittlung“ des Bundesministeriums
des Inneren.
Aufgrund der Eilbedürftigkeit (Haushaltssperre) beantragen wir die Beratung unseres Antrages gem. § 34 GemO in spätestens der übernächsten Sitzung des Gemeinderates. Danke.

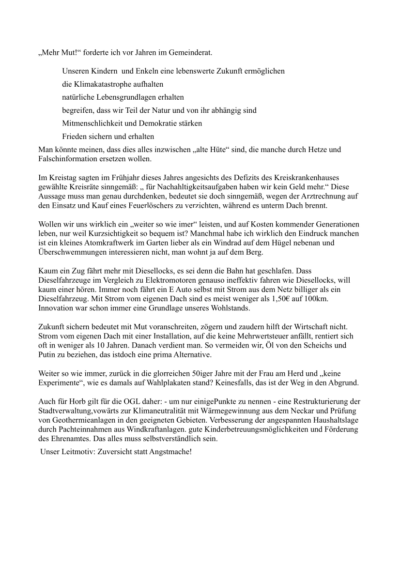
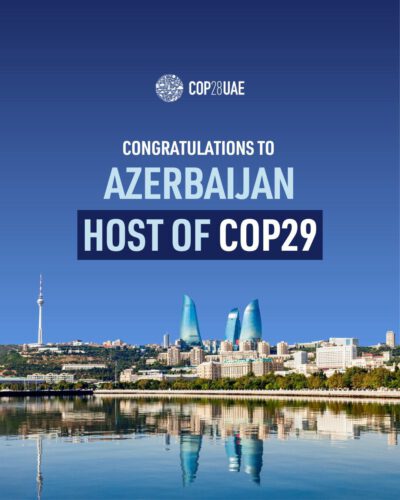

Verwandte Artikel
Haushaltsrede 2025/W.Asprion
Haushaltsrede 2025 / W. Asprion
Weiterlesen »
5 Windkraftanlagen für Horb
Winfried Asprion Offene Grüne Liste Bürger im Mittelpunkt Im Gemeinderat Horb im Gemeinderat Horb Verf.: Winfried Asprion (OGL) Herrn Oberbürgermeister Peter Rosenberger Marktplatz72160 Horb a.N. 17. März 2025 Antrag an…
Weiterlesen »
Streichung Beigeordnetenstelle
Winfried Asprion, Karin Fluhrer, Wolf Hoffmann, Thomas Bauer Offene Grüne Liste Bürger im Mittelpunkt Im Gemeinderat Horb im Gemeinderat Horb Verantw.: Winfried Asprion (OGL) Herrn Oberbürgermeister Peter Rosenberger Marktplatz 72160…
Weiterlesen »