Winfried Asprion
Offene Grüne Liste Bürger im Mittelpunkt
Im Gemeinderat Horb im Gemeinderat Horb
Verf.: Winfried Asprion (OGL)
Herrn
Oberbürgermeister Peter Rosenberger
Marktplatz
72160 Horb a.N.
17. März 2025
Antrag an den Gemeinderat
Guten Tag sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Rosenberger,
durch das Wind-an-Land-Gesetz des Bundes (2022) und das Klimaschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg (2023) wurde festgelegt, dass jede Region ihren Teil zur Energiewende in Deutschland beitragen soll. Auch Horb hat sich das Ziel der Klimaneutralität gesetzt. Der bis jetzt wenig bebaute Süden Deutschlands ist deshalb gesetzlich verpflichtet Windkraftanlagen zu errichten. Der Ausbau ist politisch gewollt, da Anlagen an windschwachen Standorten eine höhere Einspeisevergütung erhalten. Grundsätzlich muss eine betriebswirtschaftliche Bewertung des Betriebs einer Windkraftanlage ausschließlich im Fokus eines Investors stehen, nicht der Stadt Horb.
Aufgrund des schleppenden Ausbaus von Stromleitungen in den Süden und des größer werdenden Nord-Süd-Gefälles im Stromsektor ist dieses Ziel richtig und wichtig. Die generellen Ziele werden von der Landesregierung festgelegt. Zur Erreichung des Klimaschutzziels sollen Gebiete in einer Größenordnung von mindestens 1,8 % der Landesfläche bis 2032 für die Nutzung von Windenergie auf Freiflächen genutzt werden.
Der Regionalverband Nordschwarzwald hat einen Entwurf des Teilregionalplans Energie für die Region fertiggestellt und zur Anhörung offengelegt. Dieser zeigt die aktuell in Frage kommenden Gebiete für Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen auf. Die Freigabe aller Vorranggebiete wurden bereits durch den Gemeinderat Horb mehrheitlich ohne Abstufung beschlossen.
In den letzten Jahren hat sich dabei aus technischer Sicht so viel verändert, dass Flächen, die früher aufgrund der geringeren Windhöffigkeit ausgeschlossen wurden, heute wieder interessant für die Errichtung von Windkraftanlagen werden. Aufgrund der höheren Nabenhöhe erreichen Anlagen zum einen windstärkere Zonen und zum anderen konnten dadurch die Rotorblätter und damit auch die überstrichene Fläche der Flügel vergrößert werden. Mit Hilfe größerer Generatoren können Anlagen dann deutlich mehr Energie produzieren.
Wind- und Solarenergie-Anlagen produzieren bereits heute günstigeren Strom als neue Kohle-, Gas-, oder Atomkraftwerke. Strom aus Wind- und Solaranlagen sind bei Vollkostenbetrachtung (also auch der Müll- und Rückbauproblematik) die kostengünstigste Form der Stromgewinnung. Das haben die Ausschreibungsergebnisse der Bundesnetzagentur gezeigt. Demnach produzieren beide Technologien für rund 6 Cent/kWh klimafreundlichen Strom.
Unabhängig von der Energiewende müssten in den kommenden Jahrzehnten rund 40 Prozent der deutschen Stromerzeugungskapazitäten ersetzt werden. Darunter sind vor allem viele alte Kohlekraftwerke. Diese mit der gleichen Technologie ersetzten zu wollen, wäre sehr viel teurer und stände im Widerspruch zu den Klimaschutzzielen der Bundesrepublik.
(Quellen: Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE). Stromgestehungskosten für Erneuerbare Energien 2018, Forum Ökologisch Soziale Marktwirtschaft (FÖS). Was Strom wirklich kostet,Fraunhofer ISE (2021): Studie: Stromgestehungskosten erneuerbare Energien).
Nachdem nun bereits entsprechende Unternehmen bei privaten Flächenbesitzern (insbesondere in Rexingen) vorstellig werden, ist es aus unserer Sicht notwendig, zu handeln und die Hoheit über das Verfahren zu behalten.
Deshalb beantragen wir folgendes:
Der Gemeinderat möge beschließen, in einem ersten Schritt den Bau von 5 Windrädern auf kommunalen Vorrangflächen auszuschreiben. Dabei soll die Reihenfolge Freifläche vor Wald und bei Wald in Abstufung der ökologischen Wichtigkeit der Waldfläche vorgenommen werden.
Folgende Rahmenbedingungen sollten u.E. dabei eingehalten werden:
- Eine wirtschaftliche Beteiligung der Einwohner der Stadt Horb sollte nach Möglichkeit in einem gewissen Umfang gegeben werden
- Aufgrund der ökologischen Wichtigkeit kommt für uns als Standort der Große Hau grundsätzlich nicht in Frage. Wald ist eben nicht gleich Wald, genausowenig wie Acker gleich Acker ist.
- Die Ausschreibung und die erfolgende Planung sollen baldmöglichst beginnen.
Ein Ausschluß von Windkraftanlagen auf kommunalen Flächen verhindert kein einziges Windrad!
Dies muss klar und deutlich nach außen projiziert werden! Im Falle der Ablehnung der Windkraft auf kommunalen Flächen wird eben jedes Windrad auf privaten Flächen gebaut mit entsprechend negativem Einfluß auf die Handlungsfähigkeit der Stadt und auch großer finanzieller Einbußen für den kommunalen Haushalt, was in dieser Zeit besonders fatal wäre. Also kann auch ein Bürgerentscheid wie in Sulz nur für eine Verdrängung zu Lasten der Kommune sorgen.
Hier eine kleine finanzielle Betrachtung (abgeleitet aus Erfahrungswerten auch aus der Region):
die Pacht ist sehr unterschiedlich und variiert je nachdem wer zahlt (z.B. hat Vattenfall hat ein dickeres Polster als kleine Projektierer) und wie die Windhöffigkeit am Standort ist. Folgende Zahlen halten wir aufgrund vergleichbarer Projekte für realistisch:
– jährliche Fixpacht pro Anlage: 100.000€
– jährliche Umsatzbeteiligung pro Anlage: 10-12%. Von durchschnittlichen 10.000.000 kWh/a und einer Vergütung von 7,15ct/kWh ausgegangen (durchschnittlich, mengengewichteter Zuschlagswert der letzten Ausschreibung im November) –> 71.500€/Anlage (bei 10%). Davon gehen noch geringfügige und überschaubare Kosten wie Versicherung usw. ab.
– Gewerbesteuer veranlagt mit dem kommunalen Hebesatz der Stadt Horb
Bei fünf Anlagen also 800.000 – 850.000 € jährlich + Gewerbesteuer. Wir gehen von möglichen Gesamteinnahmen von rund 1.000.000 Euro pro Jahr aus (wie beantragt lediglich für 5 WKA).
Es gibt durchaus auch Firmen, die wesentlich höhere Pachtangebote machen. Dies in Abhängigkeit von der jeweiligen Unternehmens- und Wachstumsphilosophie des einzelnen Unternehmens. Dies soll aber nicht Gegenstand der Betrachtung sein.
Die Einnahmen schlagen wir wie folgt zur Verwendung vor:
- Zu 25 % Stabilisierung der Elternbeiträge für Kindergarten, Kita, Tageseltern
- Zu 25 % Zuführung in einen kommunalen Klimafonds z.B. (für Hitze- und Starkregenmanagement etc.)
- Zu 50 % Zuführung zum allgemeinen Haushalt.
Um einigen widersprüchlichen Argumtenten gleich vorab zu begegnen, noch folgende Anmerkungen:
Flächenverbrauch
Insgesamt wird etwa eine Fläche von rund 1,2 bis 1,3 Hektar für den Bau einer modernen Windenergieanlage benötigt. Nur ein Teil dieser Fläche wird für die Betriebsdauer offengehalten. Mehr als die Hälfte der Fläche wird nach Inbetriebnahme wieder bepflanzt, der Rest an überbauter Fläche wird an anderer Stelle durch Naturschutzmaßnahmen, z. B. Aufforstungen wieder ausgeglichen. Je nach Anlagentyp und topographischen Bedingungen kann die in Anspruch genommene Fläche auch größer ausfallen. Die Installation einer PV-Anlage auf der offenzuhaltenden Fläche sorgt für zusätzliche Einnahmen.
Im Vergleich zu anderen Formen der erneuerbaren Stromerzeugung haben Windkraftanlagen mit deutlichem Abstand die beste Flächeneffizienz. Mit einem Hektar landwirtschaftlicher Fläche kann man durch Biogas ca. 0,02 GWh Strom im Jahr erzeugen. Auf der gleichen Fläche schafft eine Photovoltaik-Anlage das Fünfzigfache, also 1 GWh. Je nach Standort und Windhöffigkeit produziert eine Windkraftanlage mit einem Flächenbedarf von gut einem Hektar ca. 10 GWh Strom pro Jahr. Also nochmal zehn Mal mehr als die PV-Anlage. (Quelle: biogas.fnr.de/daten-und-fakten/faustzahlen).
Stillstand der Anlagen
Die Windkraft gehört zu den volatilen oder auch fluktuierenden Energieerzeugungsarten. Windkraftanlagen produzieren Strom nicht gleichmäßig, sondern schwankend. Diese Eigenschaft gehört bei diesen Anlagen mit dazu. Trotz der Stillstandzeiten sind Windkraftanlagen wirtschaftlich und leisten einen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz.
Neben fehlendem Wind gibt es noch andere Gründe für einen vorübergehenden Stillstand der Rotorblätter: Zum einen können Windparks im Zuge der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung zu Abschaltungen verpflichtet werden. Werden beispielsweise Schattenzeiten oder Schallpegel zu bestimmten Zeiten überschritten, wird die Anlage auch trotz Wind abgeschaltet.
Auch für den Artenschutz können Abschaltzeiten festgelegt werden. Beispielsweise in den Abendstunden für den Fledermausschutz. Eisansatz bei bestimmten Wetterbedingungen, lokale Netzüberlastungen und regelmäßige Wartungen führen ebenfalls zu Stillständen.
Häufig nehmen die Stillstände eine untergeordnete Rolle im Verhältnis zum Gesamtertrag ein. Die Stillstandzeiten werden bereits in den Windgutachten berücksichtigt und sind somit Grundlage für die Investitionsentscheidung.
Infraschall
Tieffrequente Geräusche und Infraschall (Körperschall) sind bei Windenergieanlagen messtechnisch nachweisbar, aber für den Menschen nicht hörbar. Die Frequenzen bei Infraschall liegen unterhalb der durch das menschliche Ohr wahrnehmbaren Frequenzen von 16 Hz. Der menschliche Hörbereich liegt zwischen 16 Hz – 20.000 Hz. Frequenzen darüber werden als Ultraschall bezeichnet.
Infraschall ist in unserem Alltag gegenwärtig: Natürliche Quellen sind Gewitter, Wasserfälle und Meeresbrandung, u.a. technische Quellen in unserem Alltag sind Straßenverkehr, im Pkw selbst, Flugzeuge, Kühlschränke, Klimaanlagen, Industriearbeitsplätze etc.
Durch die gesetzlichen Abstände zwischen Windrädern und Wohnbebauung bleibt der von den Anlagen erzeugte Infraschall deutlich unter der Hör- und Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Mehrere Studien, unter anderem Langzeitstudien der Landesämter für Gesundheit Bayern und Baden-Württemberg belegen, dass keine gesundheitlichen Belastungen zu erwarten sind.
Weit höheren Infraschallwerten setzen wir uns täglich vollkommen freiwillig aus: Die Messwerte im Innenraum eines mit 130 km/h fahrenden Mittelklasse Pkw übersteigen die einer Windenergieanlage um ein Vielfaches. Auch gewöhnliche Geräte im Haushalt wie Waschmaschinen oder Ölheizungen verursachen nach einer Studie der LUBW mehr Infraschall als Windkraftanlagen, die 300 Meter entfernt sind. Negative Auswirkungen von Infraschall auf die menschliche Gesundheit sind auch nach derzeitigem internationalem Kenntnisstand daher nicht plausibel.
Die Annahme deutlich höherer Infraschallbelastungen durch Windenergieanlagen die in einer Untersuchung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) aus dem Jahr 2004 formuliert ist wurde zudem zwischenzeitlich mehrfach widerlegt und durch die BGR berichtigt.
Alternative? – nicht wirklich!
Mit § 6 EEG hat der Gesetzgeber Mitte 2021 ein Instrument zur finanziellen Beteiligung von Gemeinden geschaffen, die vom Ausbau erneuerbarer Energien direkt „betroffen“ sind. Die Norm wurde ursprünglich als § 36k EEG eingeführt und galt nur für Windenergieanlagen an Land. Mit der EEG-Novelle im August 2021 wurde der Geltungsbereich auf Solar-Freiflächenanlagen erweitert. Der bisherige § 36k EEG 2021 wurde in § 6 EEG 2021 überführt. Unter der Einhaltung der Voraussetzungen von § 6 EEG 2021 dürfen Anlagenbetreiber an betroffene Gemeinden einen freiwilligen Betrag, höchstens aber 0,2 ct/kWh für tatsächlich eingespeiste Strommengen zahlen. Bei Windenergieanlagen gelten dabei Gemeinden, deren Gemeindegebiet sich zumindest teilweise innerhalb eines um die Windenergieanlage gelegenen Umkreises von 2.500 Metern um die Turmmitte der Windenergieanlage befindet als betroffen. Bei Freiflächenanlagen gelten als betroffene Gemeinden solche, auf deren Gemeindegebiet sich die Freiflächenanlagen befinden. Für EEG-geförderte Anlagen kann der gezahlte Betrag vom Netzbetreiber erstattet werden. Bei den Beiträgen handelt es sich um einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung seitens der Gemeinden. Der jährliche Ertrag für die Stadt wäre als um ein Vielfaches geringer. Alle Lasten würden sozialisiert, nahezu alle Gewinne aber privatisiert!
Ökologische Betrachtung
Die Einsparung von CO2 durch Windenergieanlagen liegt um einen Faktor von mehr als 1.000 höher als die durch die dafür notwendige Rodung von Wald verlorene CO2-Aufnahme. Durch dauerhafte Rodungen für eine Windenergieanlage im Wald können zwischen zwei und drei Tonnen CO2 pro Jahr nicht mehr aufgenommen werden. Eine durchschnittliche Windenergieanlage in Deutschland erzeugt im Jahr etwa 6 Millionen Kilowattstunden Strom und spart damit 3.600 Tonnen CO2 ein – bei Anlagen mit 4,5 Megawatt Leistung sind es bereits knapp 5.000 Tonnen CO2 . Die neueste Generation von Windenergieanlagen ist mit insgesamt 240 bis 290 Metern zwar noch höher, aber die Anlagen können dafür mit 6 Megawatt doppelt viel Leistung bringen und entsprechend noch mehr CO2 einsparen.
In der Gesamtabwägung sehen wir viel mehr Chancen als Risiken in der Windkraft und möchten daher gerne schnellstmöglich im Gemeinderat über unseren Antrag beraten.
Freundliche Grüße
Winfried Asprion
Wolf Hoffmann
Dr. Karin Fluhrer
Thomas Bauer

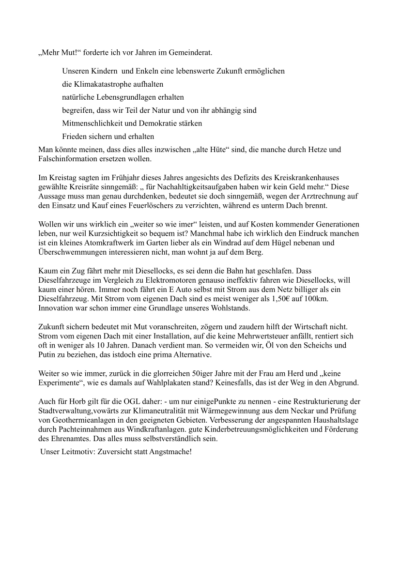
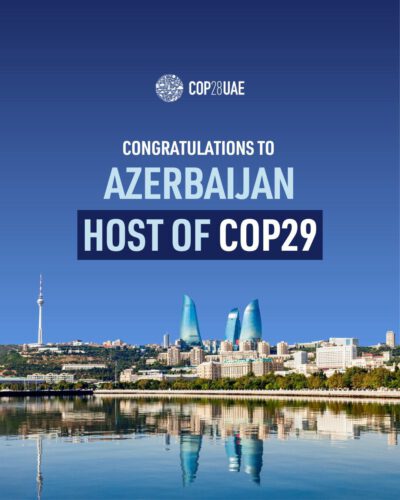

Verwandte Artikel
Haushaltsrede 2025/W.Asprion
Haushaltsrede 2025 / W. Asprion
Weiterlesen »
Streichung Beigeordnetenstelle
Winfried Asprion, Karin Fluhrer, Wolf Hoffmann, Thomas Bauer Offene Grüne Liste Bürger im Mittelpunkt Im Gemeinderat Horb im Gemeinderat Horb Verantw.: Winfried Asprion (OGL) Herrn Oberbürgermeister Peter Rosenberger Marktplatz 72160…
Weiterlesen »
Sparen durch Verwaltungsumbau
von Winfried Asprion Offene Grüne Liste Bürger im Mittelpunkt Im Gemeinderat Horb im Gemeinderat Horb Verantw.: Winfried Asprion (OGL) Herrn Oberbürgermeister Peter Rosenberger Marktplatz 72160 Horb a.N. 08. Oktober 2024…
Weiterlesen »